In der BMBF-Förderbekanntmachung „Gesellschaftliche Ursachen und Wirkungen des radikalen Islam in Deutschland und Europa“ forschen zwölf Forschungsprojekte zu den vielen Facetten des Phänomenbereichs radikaler Islam: Welche Gründe lassen sich für das Erstarken islamistischer Tendenzen im deutschsprachigen und europäischen Raum identifizieren? Wie wirken islamistische Strömungen auf bestimmte gesellschaftliche Gruppen oder die Gesellschaft als Ganzes? Und was folgt aus diesen Erkenntnissen für die Arbeit der Präventionspraxis, Politik und Verwaltung, Zivilgesellschaft, Sicherheitsbehörden und Medien? Diesen und weiteren Fragen gehen Forschende vieler verschiedener Disziplinen aus unterschiedlichsten theoretischen und methodischen Blickwinkeln im Zeitraum von 2020 bis 2025 nach.
Diese Webseite bündelt die Aktivitäten und Ergebnisse der einzelnen Forschungsvorhaben. Außerdem finden sich hier projektübergreifende Erkenntnisse aus dem Netzwerk und der dialogischen Zusammenarbeit des Transfervorhabens RADIS.

Einblicke in den Crisis Talk "Der ewige Antisemitismus und der Schutz jüdischen Lebens in Europa – Was tun?" am 5. März 2024 in der Hessischen Landesvertretung in Brüssel.
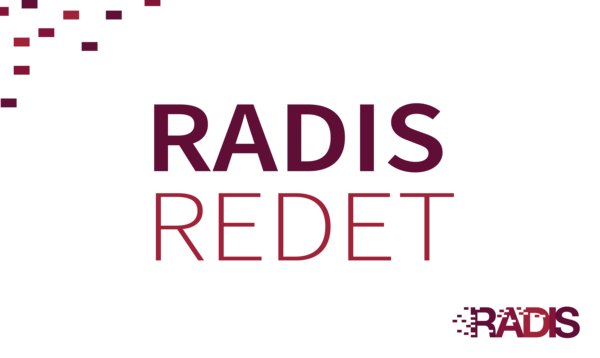
Gemeinsam mit Expert:innen aus dem RADIS-Netzwerk greifen wir auf, was die Forschenden umtreibt. Wir beleuchten, wie Wissenschaft und Praxis zusammenarbeiten, um Radikalisierung zu begegnen. Und wir fragen, wie sich der Umgang mit Islamismus auf die Gesellschaft auswirkt – auch und insbesondere auf muslimisches Leben.
Die vierte Folge ist jetzt online. Mit Prof. Gert Pickel und Jouanna Hassoun stellen wir uns die Frage, wie wir zwischen Muslimfeindlichkeit und Antisemitismus einen Raum für offene Gespräche schaffen.

Reaktionen in Deutschland auf den terroristischen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober zeigten auf drastische Weise, dass extremistische, antisemitische und antimuslimische Haltungen hier weit verbreitet und mutmaßlich tief verwurzelt sind. Unsere neue Blogserie liefert Analysen, die über die jüngsten Ereignisse hinaus dabei helfen, aktuelle gesellschaftliche Dynamiken rund um Islamismus und Radikalisierung zu verstehen und damit umzugehen.

Die Forschenden der RADIS-Förderlinie haben sich auf der interdisziplinären Fachtagung im Februar intensiv mit Expert:innen aus dem Feld ausgetauscht. Im Mittelpunkt standen aktuelle Erkenntnisse aus der Radikalisierungsforschung im Phänomenbereich Islamismus.
Film "Das Projekt Ressentiment" | Länge 1"52' | Realisation Ute Seitz // Shaimaa Abdellah | PRIF 2024
Prozesse der Radikalisierung und des Extremismus bedrohen europäische Gesellschaften auf vielfältige Weise. Doch wie reagieren unterschiedliche Institutionen auf islamistische Anschläge und welche gesellschaftlichen Folgen resultieren daraus? Welche Rolle spielen Sozialisation und Ressentiments bei Prozessen der (De-)Radikalisierung? Was charakterisiert salafistische Ideologien?
In über 20 Vorlesungen wurden diese Fragen adressiert und die aktuellen Aspekte aus der Förderlinie beleuchtet. Sie finden weitere Informationen zu den einzelnen Vorlesungen hier und können die Aufzeichnungen auf Youtube ansehen.
